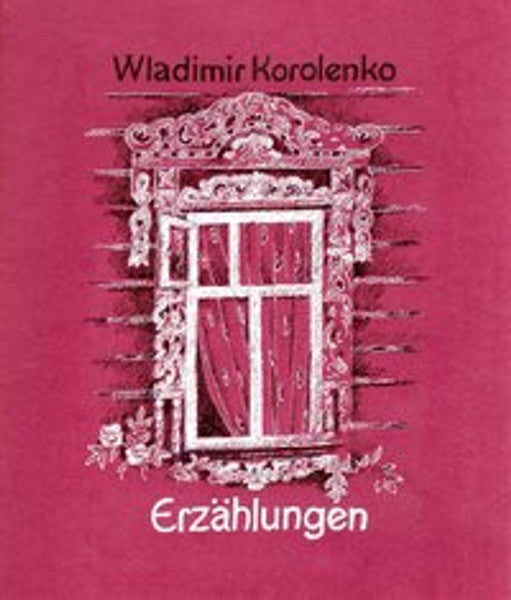Aus der Einleitung zu seinem Buch „Die Geschichte meines Zeitgenossen“
Von Rosa Luxemburg
Korolenko ist eben seiner Abstammung nach Pole, Ukrainer und Russe zugleich, und schon als Kind mußte er dem Ansturm der drei »Nationalismen« stand halten, von denen jeder ihm zumutete, »irgend jemanden zu hassen und zu verfolgen«. An der gesunden Menschlichkeit des Knaben scheiterten frühzeitig alle derartigen Versuchungen. Die polnischen Traditionen wehten ihn nur als letzter ersterbender Hauch einer geschichtlich überwundenen Vergangenheit an. Von dem ukrainischen Nationalismus fühlte sein gerader Sinn sich durch das Gemisch von maskeradenhaftem Geckentum und reaktionärer Romantik abgestoßen. Und die brutalen Methoden der offiziellen Russifizierungspolitik gegenüber den unterdrückten Polen wie den Unierten in der Ukraine waren eine wirksame Warnung vor dem russischen Chauvinismus für ihn, den zarten Knaben, der stets instinktiv zu den Schwachen und Bedrückten, nicht zu den Starken und Triumphierenden sich hingezogen fühlte. Aus dem Widerstreit der drei Nationalitäten, dessen Feld seine wolhynische Heimat war, rettete er sich in die Humanität.
Mit 17 Jahren vaterlos und materiell ganz auf sich gestellt, geht er nach Petersburg, um sich in den Strudel des Universitätslebens und der politischen Gärung zu stürzen. Nach dreijährigem Studium am Technikum zieht er auf die Landwirtschaftliche Akademie in Moskau. Allein schon nach zwei Jahren werden seine Lebenspläne, wie bei so manchem seiner Generation, durch die »höhere Gewalt« durchkreuzt. Korolenko wird als Teilnehmer und Wortführer einer Studentendemonstration verhaftet, von der Akademie relegiert und nach dem Gouvernement Wologda im Norden des europäischen Rußlands verschickt, später zum Domizil unter polizeilicher Aufsicht nach Kronstadt entlassen. Nach Jahren kehrt er nach Petersburg zurück, um wieder Lebenspläne zu bauen, erlernt hier das Schuhmacherhandwerk, um im Sinne seiner Ideale den arbeitenden Volksschichten näher zu treten und zugleich eine vielseitige Entwicklung der eigenen Individualität zu fördern, wird jedoch im Jahre 1879 abermals verhaftet und diesmal weiter nordöstlich, nach dem Gouvernement Wjatka, in ein ganz weltentlegenes Nest verschickt. Auch damit findet sich Korolenko mit heiterer Laune ab. Er sucht sich in dem neuen Verbannungsort schlecht und recht einzurichten und betreibt fleißig sein neuerlerntes Handwerk, um auf diese Weise auch seinen Unterhalt zu bestreiten. Doch die Ruhe sollte ihm nicht lange gegönnt werden. Plötzlich wird er ohne jeden ersichtlichen Grund nach Westsibirien überführt, von da wieder nach Perm, von Perm aber nach dem äußersten Osten Sibiriens. Allein auch hier war seinen Wanderungen noch kein Ziel gesetzt.
Im Jahre 1881 trat, nach dem Attentat auf Alexander II., der neue Zar Alexander III. auf den Thron. Korolenko, der inzwischen Eisenbahnbeamter geworden war, leistete zusammen mit dem übrigen Dienstpersonal den üblichen Eid an die neue Regierung. Dies wurde jedoch nicht für genügend erachtet. Er sollte auch als Privatperson, als »politischer Verbannter« den Treueid leisten. Korolenko wies - wie alle anderen Verbannten - diese Zumutung ab und wurde dafür nach den Eiswüsten des Distrikts Jakutsk verschickt. Es war dies zweifellos eine »leere Demonstration«, so wenig demonstrativ sie von Korolenko gemeint war. Ob ein einsamer Verbannter irgendwo in der sibirischen Tajga, in der Nähe des Polarkreises, der Zarenregierung seinen Untertaneneid schwor oder nicht, das änderte materiell und unmittelbar an den bestehenden Verhältnissen nicht das geringste. Es war aber im zaristischen Rußland Brauch, dergleichen leere Demonstrationen zu machen.
Übrigens nicht in Rußland allein, war denn das eigensinnige Eppùr si muove Galileo Galileis nicht eine ebensolche leere Demonstration, ohne andere praktische Wirkung, als die Rache der heiligen Inquisition an dem gefolterten und eingekerkerten Manne? Und doch ist für Tausende von Menschen, die von der kopernikanischen Lehre nur die nebelhafteste Vorstellung haben, der Name Galileis für immer an jene schöne Geste geknüpft, an der es ganz nebensächlich ist, daß sie nicht einmal stattgefunden hat. Eben die Legenden, mit denen die Menschheit ihre Helden zu schmücken liebt, sind ein Beweis, wie sehr ihr dergleichen »leere Demonstrationen«, trotz ihres unwägbaren materiellen Nutzens, im geistigen Gesamthaushalt ein unentbehrlicher Posten sind.
Vier Jahre mußte Korolenko für seine Eidesverweigerung in einer elenden Niederlassung halbwilder Nomaden, am Ufer Aldans, eines Nebenflusses der Lena, mitten im sibirischen Urwald, bei Wintertemperaturen von 40–45 Kältegraden büßen. Doch alle Entbehrungen, Einsamkeit, die düstere Szenerie der Tajga, elende Umgebung, Abgeschiedenheit von der Kulturwelt vermochten der geistigen Elastizität und dem sonnigen Temperament Korolenkos nichts anzuhaben.
Er nimmt eifrig an dem kümmerlichen Leben und den Interessen der Jakuten teil, ackert fleißig, mäht Heu und melkt Kühe, im Winter verfertigt er für die Eingeborenen Schuhwerk oder auch Heiligenbilder .... Über diese Periode des »Lebendigbegrabenseins«, wie George Kennan das Dasein der Verbannten von Jakutsk nannte, berichtet Korolenko später in seinen Skizzen ohne Klage, ohne jede Bitterkeit, ja, mit Humor, in Bildern von zartester, poetischer Schönheit. Sein dichterisches Talent reift indessen und er sammelt eine reiche Beute an Natureindrücken und psychologischen Beobachtungen.
1885, endlich zurückgekehrt aus der Verbannung, die ihn mit kurzer Unterbrechung fast zehn Jahre seines Lebens gekostet hat, veröffentlicht er eine kleine Erzählung, die ihn mit einem Schlage unter die Meister der russischen Literatur reiht: »Makars Traum«. In der bleiernen Atmosphäre der 80er Jahre wirkte diese erste ganz reife Frucht des jungen Talents wie das erste Lerchenlied an einem grauen Februartag.
In rascher Folge reihten sich nun weitere Skizzen und Erzählungen an: »Aufzeichnungen eines sibirischen Touristen«, »Der Wald rauscht«, »Dem Heiligenbilde nach«, »In der Nacht«, »Jom Kippur«, »Der Fluß schäumt« und viele andere. Sie alle weisen dieselben Grundzüge des Korolenkoschen Schaffens auf: Zauberhafte Landschafts-und Stimmungsmalerei, liebenswürdige, frische Natürlichkeit und warmherziges Interesse für die »Erniedrigten und Enterbten«. Diese starke soziale Note in Korolenkos Schriften hat jedoch gar nichts Lehrhaftes, Streitbares, Apostolisches an sich, wie etwa bei Tolstoj. Sie ist einfach ein Teil seiner Liebe zum Leben, seines gütigen Naturells, seines sonnigen Temperaments. Bei aller Großzügigkeit und Weitherzigkeit der Ansichten, bei aller Abneigung dem Chauvinismus gegenüber, ist Korolenko durch und durch ein russischer Dichter, vielleicht der nationalste unter den großen Prosaikern der russischen Literatur.
Er liebt nicht bloß sein Land, er ist in Rußland verliebt wie ein Jüngling, verliebt in seine Natur, in die intimen Reize jeder Gegend des Riesenreiches, in jedes schläfrige Flüßchen und jedes stille waldumsäumte Tal, verliebt in das einfache Volk, seine Typen, seine naive Religiosität, seinen urwüchsigen Humor und seinen grübelnden Tiefsinn. Nicht in der Stadt, nicht im bequemen Eisenbahnabteil, nicht im Rummel und in der Hast des modernen Kulturlebens: nur auf der Landstraße fühlt er sich in seinem Element. Mit Rucksack und selbstgeschnittenem Wanderstab, »in leichtem Wanderschweiße« fürbaß ausschreiten, sich dem Zufall hingeben, bald einem Trupp frommer Pilger zum wundertätigen Heiligenbild folgen, bald am Flußufer gelagert bei nächtlichem Feuer mit Fischern plaudern, bald auf einem schläfrig dahinkriechenden, kleinen defekten Dampfschiff, in eine bunte Menge Bauern, Holzhändler, Soldaten, Bettler gemischt, ihre Gespräche belauschen, - das ist die Lebensweise, die ihm am besten behagt. Und er bleibt auf diesen Wanderungen nicht bloß Beobachter, wie Turgenjew, der feine, gepflegte Aristokrat.
Korolenko kostet es gar keine Mühe, mit Leuten aus dem Volke nach wenigen Worten Fühlung zu bekommen, ihren Ton zu treffen, in der Menge unterzutauchen. Fast ganz Rußland hat er auf diese Weise kreuz und quer zu Fuß durchwandert. Hier sog er auf jedem Schritt den Zauber der Natur, die naive Poesie der Primitivität ein, die auch Gogol ein Lächeln entlockte, hier beobachtete er mit Entzücken das elementare fatalistische Phlegma des russischen Volkes, das in ruhigen Zeiten unerschütterlich und unerschöpflich scheint, um in Augenblicken des Sturmes in Heldenmut, Größe und stahlharte Kraft umzuschlagen - ganz wie jener liebliche Fluß seiner Erzählung, der bei gewöhnlichem Wasserstand sanft und demütig dahinplätschert, bei Hochwasser aber zu einem stolzen, ungeduldigen, prächtig drohenden Strom anschwillt. Hier, im unmittelbaren und ungezwungenen Verkehr mit der Natur und dem einfachen Volke, füllte Korolenko sein Tagebuch mit frischen, farbigen Eindrücken, die fast unverändert, noch von blinkenden Tautropfen bedeckt, von Erdgeruch umweht, seine Skizzen und Novellen ergaben.
Ein eigenartiges Produkt der Korolenkoschen Feder ist »der blinde Musiker«. Anscheinend ein rein psychologisches Experiment, behandelt das Werk, streng genommen, kein künstlerisches Thema. Angeborene Krüppelhaftigkeit kann zwar Quelle vieler Konflikte im menschlichen Leben werden, ist aber selbst jenseits des menschlichen Wollens und Handelns, jenseits von Schuld und Sühne, ausgenommen etwa die Fälle, wo sie als Erbstück das Verschulden der Eltern zum Fluche der Kinder macht. Deshalb werden körperliche Gebrechen sowohl in der Literatur wie in der bildenden Kunst nur episodisch behandelt, entweder in satirischer Absicht, um die geistige Häßlichkeit einer Gestalt noch verächtlicher zu machen, wie im Falle des Thersites bei Homer (auch etwa der stotternden Richter in den Komödien Molières und Beaumarchais'), oder mit gutmütig-humoristischem Einschlag, wie auf den Genrebildchen der niederländischen Renaissance, z. B. auf der Krüppelskizze von Cornelis Dussart. Anders bei Korolenko: Das seelische Drama des Blindgeborenen, der von einem unwiderstehlichen Drang zum Licht gepeinigt wird, ohne ihn je befriedigen zu können, steht hier im Mittelpunkt des Interesses, und die Lösung, die ihm Korolenko gibt, führt unerwartet wieder auf den Grundton seiner Kunst wie der russischen Literatur überhaupt. Sein blinder Musiker erlebt eine geistige Wiedergeburt, er wird geistig »sehend«, indem er aus dem Egoismus seines eigenen ausweglosen Leides heraustritt, um sich zum Sprachrohr der Leibes-und Seelennot aller Blinden zu machen. Den Höhepunkt der Studie bildet das erste öffentliche Wohltätigkeitskonzert des Blinden, der auf seinem Instrument unerwartet die bekannte Melodie der blinden Bänkelsänger in Rußland variiert und zum Thema einer Improvisation macht, die das aufhorchende Publikum in einer Aufwallung heißen Mitleids erbeben läßt. Das soziale Element, die Solidarität mit dem Massenleid ist hier das Rettende und Lichtspendende für den Einzelnen wie für die Allgemeinheit."
– Die Geschichte meines Zeitgenossen: Erster Band von Wladimir Galaktionovich Korolenko
Buchbesprechung in "Goetheanum"
Das personifizierte Gewissen seiner Zeit in Russland - Wladimir Korolenko (1853-1921)
Aufgewachsen im zaristischen Russland, gestorben in der Sowjetrepublik, übersetzt von Rosa Luxemburg, spricht sich Wladimir Korolenko deutlich gegen die Verallgemeinerung des Elends aus. Sein jahrelanges Eintauchen in das Volk und dessen inneren sozialen Zusammenhänge, die sich nicht aus der Theorie erklären lassen, erscheinen in seinen Erzählungen nicht in erster Priorität als ästhetische, sondern als gerechte Darstellungen des Lebens der Armen.
Peter Stühl
Warum wurde diese durch viel Leid erworbene, humanitäre Autorität Russlands, W. Korolenko, nicht neben den großen Dichtern dieses Landes als das gewürdigt, was sie für viele Zeitgenossen war: ein erster ‹Menschrechtler?›
Seine Kindheit durchlebte Wladimir Korolenko im Zarenreich in dem kleinen Dörfchen Schytomyr als eines von fünf Kindern des Landrichters Galaktion Korolenko. Der Tod des Vaters stürzte die Familie in bittere Armut, dennoch schloss der Junge die Schule mit Auszeichnung ab, ging nach Sankt Petersburg und nahm dort das Studium an der Technischen Hochschule auf. Später kam er nach Moskau und schrieb sich an der Akademie für Land- und Forstwirtschaft ein. Neben dem Studium engagierte sich Korolenko vielfach in studentischen revolutionären Bewegungen. Dies führte 1876 zu seiner Zwangsexmatrikulation sowie Festnahme und Verbannung nach Kronstadt. Nach der Freilassung 1877 lebte er in Sankt Petersburg, wo er anfing, Erzählungen zu schreiben. 1879 wurde er erneut verhaftet und für sechs Jahre nach Sibirien verbannt. Dort arbeitete er in der Landwirtschaft sowie im Schuhmacherhandwerk und verarbeitete seine Eindrücke in mehreren Erzählungen. Im Jahr 1885 kam Korolenko ins europäische Russland zurück und liess sich mit behördlicher Erlaubnis in Nischni Nowgorod nieder. Dort schrieb er weitere Erzählungen für verschiedene Zeitschriften und wurde 1886 mit Leo Tolstoi und 1889 mit Maxim Gorki bekannt. Während der Hungersnot 1892 engagierte er sich für arme Bauern. Viele seiner Erzählungen beleuchten den schwierigen Alltag russischer Bauern.
1896 siedelte Korolenko erneut nach Petersburg über, wo er als Redakteur der Zeitschrift Russkoje Bogatstwo tätig wurde, die den Narodniki nahe stand. 1900 ging er nach Poltawa und setzte sich dort unter anderem für die aufständischen Bauern sowie gegen die Hinrichtungen von Revolutionären nach dem gescheiterten Volksaufstand von 1905 ein. In dieser Zeit schrieb er eine Reihe von Erzählungen und Aufsätzen, von denen einige als regierungskritisch galten, weswegen die Staatsmacht mehrmals versuchte, Korolenko anzuklagen. Nach der Oktoberrevolution 1917 und während des darauffolgenden Bürgerkrieges lebte er weiterhin in Poltawa, engagierte sich wohltätig und versuchte mehrmals, zwischen den Bürgerkriegsparteien zu vermitteln. 1921 starb er an einer Lungenentzündung. Sein wichtigstes Werk, die von 1905 bis 1921 entstandene autobiografische Geschichte meines Zeitgenossen, wurde vollständig erst nach seinem Tode herausgegeben. 1919 erschien in Deutschland das von Rosa Luxemburg übersetzte erste Buch (Verlag Paul Cassirer, Berlin).
Dieser Dichter wurde zum nationalen Gewissen Russlands, weil er nicht nur die sozialen Verhältnisse beschreiben konnte, sondern weil er sich konkret einsetzte und kämpfte für die Autonomie des Menschen. Er sagt von sich: ‹‹Ich bin einfach ein Schriftsteller, der für Recht und Freiheit für alle Bürger unseres Vaterlandes schwärmt und als Kämpfer überall dort auftritt, wo Recht und Freiheit verletzt wird.››
Das Elend der einfachen Menschen...
Eine kennzeichnende, ja direkt eine symbolische Darstellung des russischen Bauern gibt uns Korolenko in
seinem Helden Makar aus dem ‹Traum des Makars›. Das ist der echte russische Bauer, der schwer arbeitet, arm lebt, Hunger und Kälte leidet. Gleichzeitig tritt hier die Korolenko so eigentümlich Art des soziologischen Herantretens an das zu lösende Problem hervor. Der Dichter zeigt uns zunächst die soziale Lage Makars. Sein Leben lang wird der arme Makar gehetzt. Es hetzt ihn der Dorfschulze, es hetzt ihn der Landrat, Steuern werden von ihm eingetrieben, der Pope verlangt Kirchenbeiträge. Das Elend plagt ihn, der Hunger und der Frost peinigen ihn, die Dürre, der Regen, der böse Urwald üben einen wirtschaftlichen Druck auf den armen Wicht aus. Er muss Holz fällen, als seine erste Frau krank liegt. Es ist ihm schwer ums Herz, er würde gern bei seiner Alten gesessen haben, aber die Not treibt ihn in den Wald. Im Walde weint er, die Tränen gefrieren auf seinen Wimpern, und Kummer und die Kälte dringen in sein Herz. Aber er fällt Holz. Dann stirbt seine Frau. Sie muss beerdigt werden, er aber hat kein Geld. Wieder muss er sich zum Holzfällen verdingen, um für das ‹Haus› seiner Frau auf jener Welt zu bezahlen . . . Der Unternehmer sieht, dass ihn die Not drückt, und zahlt trotzdem nur 10 Kopeken. Die Alte liegt im ungeheizten durchfrorenen Hause, und er fällt weiter Holz und weint ... . So lesen wir buchstäblich in Korolenkos Erzählung.
...zur Sprache gebracht
An einer anderen Stelle zeichnet Korolenko uns das Bild eines Dorfes. Seiner Einstellung gemäß kommt er bald von der Schilderung des äußeren Anblicks zu wirtschaftlich-sozialen Betrachtungen und fragt nach den Bewohnern.
Er lässt die Bauern selber sprechen: ‹‹Sind wir denn Bewohner, sehen Sie uns einmal an. - Was sind wir für Bewohner, was ist da schon zu reden? Ein Bewohner, das ist ein Bauer, ein Wirt, ein selbständiger Mensch, im Gegensatz zum obdachlosen, wirtschaftslosen Bettler.›› Es ist ein niederschmetternder, bedrückender Eindruck, den diese Worte: ‹‹Was sind wir für Bewohner?›› auf den Dichter und den Leser machen, wenn man bedenkt, dass das ganze geschilderte Dorf jenes von sich aussagt. Erniedrigung, Trostlosigkeit, niedergeschlagene Augen, Scham vor der eigenen Existenz. Solche Dörfer hat Korolenko auf seinen Wanderungen Dutzende gesehen und beschrieben, ja ganze Landstriche und Kreise. Darum sträubt er sich so sehr dagegen, wenn man vom ‹russischen Bauern› schlechthin spricht. ‹‹Das nämlich ist der springende Punkt,›› sagt er, ‹‹dass es einen einzigen unzertrennbaren, einfachen Bauern gar nicht gibt. Es existieren Fedots und Ivans, Arme und Reiche, Bettler und ‹Kulaks›, Gute und Böse, Sorgsame und Säufer, solche, die Land haben, und andere, die landlos sind, Wirte und Arbeiter.›› Der laienhaften Intelligenz seiner Zeit schien das Bauernvolk einer Herde Spatzen gleich; einer sah wie der andere aus, nach dem Bilde des Erstbesten urteilte man über sämtliche Bauern.
Wahrgenommen werden - ein Menschenrecht
Korolenko liebte die Schönheiten der russischen Natur, liebte das einfache Volk und seine Typen, mit ihrem naiven Glauben, ihrem urwüchsigen Humor und der dem Russen eigenen Nachdenklichkeit. Er betrachtete das Volk aber nie von der Seite, aus der Entfernung, wie etwa der Aristokrat Turgenev, sondern hat es verstanden, sich mit dem Volke zu verschmelzen. Er fand stets sofort den richtigen Ton und die richtige Art, an den Bauern heranzutreten. Er tauchte förmlich im Volke unter. Deshalb öffnete sich ihm, wie keinem anderen, die Volksseele.
Der Bauer lässt sich nicht gern von einem Städter interviewen, von einem der ‹Herren› ausfragen, auch wenn sie wie Turgenev als Jäger verkleidet zu ihnen kommen. Auch schildert Korolenko die Landschaften und Volkstypen nie aus der Perspektive seines Schreibtisches etwa oder aus dem Abteil des Eisenbahnwagens. Nicht im Lärm und Treiben des städtischen Kulturlebens, sondern auf der Landstraße fühlt sich der Schriftsteller wohl. Mit dem Rucksack auf dem Rücken und einem dicken Knüppel in der Hand durchwandert er fast ganz Russland. Ohne vorher aufgestellten Plan lässt er sich vielmehr vom Zufall treiben, schließt sich einmal einer Gruppe von Pilgern an, die einem wundertätigen Heiligenbilde zustreben. Ein andermal gesellt er sich den am Ufer des Flusses übernachtenden Fischern zu und plaudert mit ihnen beim Schein des Feuers, an dem sie ihre müden Körper ausstrecken. Ein drittes Mal mengt er sich unter die bunte Gesellschaft von Bauern, Holzhändlern, Soldaten und Bettlern, die auf einem Wolgadampfer reisen, hört Ihnen zu und mischt sich in ihre Unterhaltung ein, und so in dieser Art fort die langen Jahre hindurch. Auf diese Weise sammelte er seine Eindrücke, ist nicht Beobachter von außen, der nur das äußere Bild sieht und es nach ästhetischen oder ähnlichen Grundsätzen beurteilt, sondern steht mitten im Volke und seinem Leben und lernt die inneren sozialen Zusammenhänge höher schätzen als all den anderen Tand, der ja auch nicht bedeutungslos und vielleicht auch sehr interessant, aber nicht in erster Linie für eine gerechte Darstellung maßgebend ist.